Automatische Bewässerung für Gärten und Grünflächen
Was auf Golf- und Sportplätzen schon lange Standard ist, kommt nun in Gärten und Grünflächen an: die Internet-basierte Bewässerungssteuerung. Sie ist Teil des „Smart Gardening" mit Mährobotern und gesteuerter Beleuchtung. Was bietet der Markt, was sind Vor- und Nachteile?
- Veröffentlicht am

Wie bei vielen Neuerungen haben einige Pioniere und Start-ups versucht, Anwendungen für die Bewässerung als browserbasierte Software oder als Steuerung per App am Markt zu etablieren. Wie so oft, sind viele von ihnen wieder verschwunden, auch wenn die Anwendungen sehr innovativ und durchaus brauchbar waren. Allen diesen Bewässerungssteuerungen gemein ist, dass die Idee dahintersteckt, die Bewässerungsanlagen von jedem Punkt der Erde programmieren und überwachen zu können. Hinzu kommen bei einigen Anbietern automatische Funktionen, durch die eine optimale Bewässerung der Flächen erreicht werden soll – bei möglichst geringem Wasserverbrauch.
Bevor man sich für eine smarte Bewässerungssteuerung entscheidet, sollte man sich überlegen, ob man diese Technik überhaupt benötigt. Klassische Steuergeräte der führenden Hersteller haben bereits viele Funktionen, mit denen eine wassersparende automatisierte Bewässerung erreicht werden kann. Will man aber die Nachjustierung der Bewässerungszeiten oder anderen Einstellungen nicht vor Ort am Steuergerät vornehmen, benötigt man eine Verbindung von einer Software zum Steuergerät. Diese Möglichkeit eröffnet auch dem Servicebetrieb ohne großen Aufwand die Nachjustierung einer Kundenanlage. Alarmfunktionen melden automatisch Probleme in den Anlagen, zum Beispiel Rohrbrüche, Kurzschlüsse und andere Fehler. Automatische Funktionen bei Alarmen können zum Teil eingestellt werden. Wetterereignisse und -prognosen sind bei einigen Anbietern zur automatischen Anpassung eingebunden.
Fernüberwachung für kleine bis mittlere Anlagen
Mittels Bluetooth können bereits batteriebetriebene Steuergeräte über eine App programmiert und bedient werden, ohne direkt zum Steuergerät gehen zu müssen. Selbst für am Wasserhahn montierte „Bewässerungscomputer" ist die Bluetooth-Technik verfügbar. Die Kommunikation über Bluetooth ist aber eine reine Fernsteuerung, bei der das Mobiltelefon als Sender fungiert. Eine Überwachung der Anlagen ist aber bei diesen Geräten der meisten Anbieter noch nicht möglich. Die Reichweite aufgrund der geringen Sendeleistung ist stark eingeschränkt.
Steuergeräte mit WLAN oder LAN-Anbindung an eine cloudbasierte Software bieten dieses Feature bereits bei sehr günstigen Einstiegspreisen. Die Nutzung der Software ist bei den meisten Anbietern bis zu einer bestimmten Anzahl von Steuergeräten kostenlos.
- Mit WLAN-Schnittstellen aufrüstbare Steuergeräte: Einige Modelle klassischer Steuergeräte können mit einem WLAN-Stick zu einem modernen Steuergerät mit Cloudanbindung und App-Steuerung aufgerüstet werden. Zu dieser Kategorie gehören zum Beispiel die Rainbird-Steuergeräte der Typenreihe ESP-RZXe und das Hunter X2.
Beim Rainbird ESP-RZXe kann die WLAN-Schnittstelle auch als Fernbedienung benutzt werden, wenn kein Internetanschluss über das lokale Netzwerk erfolgt ist. Eine automatische Anpassung der Bewässerungszeiten auf Grundlage der von Wetterdiensten bereitgestellten Daten erfolgt in diesem Offline-Modus nicht.
Änderungen der Bewässerungszeiten können am Steuergerät direkt eingegeben werden. Diese werden aber bei Änderungen in der App von diesen wieder überschrieben. Ähnlich ist dies beim Hunter X2, bei dem, sobald die Schnittstelle eingebaut ist, die Programmierfunktion am Gerät nicht mehr möglich ist.
- Vorhandene Steuergeräte aufrüsten: Steuergeräte von Hunter können durch den Austausch der Frontplatte (ProC) und durch Austausch der Frontplatte und des Hauptmoduls (ICC2) zu WLAN-fähigen Geräten umgebaut werden.
Die Geräte der Rainbird Typenreihen ESP-LMX und die Hunter ICC2 und ACC2 können mit einer Zusatzkartusche zu GPRS- oder LAN-fähigen Geräten aufgerüstet werden, die dann an die jeweilige Cloud-Software angebunden werden können. Mit einem Zusatzmodul können mit den Rainbird ESP-LMX auch 9VDC-Steuergeräte Typenreihe TBOS in die cloudbasierte Anlage eingebunden werden, was bei größeren Parkanlagen sehr nützlich sein kann.
- Steuergeräte, die speziell für die cloudbasierten Anwendungen entwickelt wurden: Zu dieser Kategorie gehören unter anderem die Steuergeräte der Typenreihe HC, PROC-HC und HCC von Hunter, die Geräte von Samcla und von Irrigation Caddy, einem der Pioniere der cloudbasierten Bewässerungssteuerungen für den Consumer-Bereich. Mit Samcla-Geräten können auch Magnetventile über die Cloud programmiert werden, die keine Kabelverbindung zur Steuerung haben. Vom Hub, der über WLAN mit der Cloud verbunden ist, werden über Funk die betreffenden Daten an die batteriebetriebene 9VDC-Steuereinheit gesendet. Eine Mischung zwischen kabelgebundenen 24VAC- und 9VDC-Magnetventilen ist mit den Samcla-Geräten möglich.
Komplexe Anlagen übersichtlich programmieren
Komplexe Bewässerungsanlagen mit vielen Zonen können ohne größeren Aufwand nur mit einem zentralen Steuerungssystem auf die Ansprüche der jeweiligen Pflanzengesellschaft abgestimmt und wassersparend betrieben werden. In größeren Anlagen mit vielen Abschnitten und in Kommunen mit vielen dezentral liegenden Sportplätzen können die Bewässerungsanlagen mit einer cloudbasierten Bewässerungssteuerung vom zuständigen Personal vom Schreibtisch aus komfortabel überwacht und ferngewartet werden, ohne dass eine Bewässerungssteuerung auf einem eigenen Server installiert werden muss.
Bei komplexen Anlagen können cloudbasierte Systeme gewählt werden, die über einen Passwortschutz erlauben, die Zugangserlaubnis zu den Zonen hierarchisch aufzubauen.
In einer mehrere Hektar großen Anlage, zum Beispiel im Palmengarten in Frankfurt, der in verschiedene Reviere aufgeteilt ist, können dezentral montierte Steuergeräte mithilfe einer cloudbasierten Software zentral von den Büros aus bedient werden. In den einzelnen Revieren erfolgen Einstellungen, Anpassungen und manuelle Funktionen auch direkt an den Steuergeräten. Bei der Synchronisation zwischen Steuergerät und Software können die Gärtner entscheiden, ob die Änderungen, die am Steuergerät vorgenommen wurden, übernommen werden sollen, oder ob die in der Software eingegeben Werte an das Steuergerät übergeben werden, die dann die lokal vorgenommenen Änderungen überschreiben.
Um zu verhindern, dass jeder, der Zugang zu der Software hat, alle Einstellungen verändert, kann man Benutzerrechte hinterlegen. Auf diese Weise kann zum Beispiel der Amtsleiter alle Rechte haben, die Revierleiter nur auf die Geräte innerhalb der Reviergrenzen vollen Zugriff haben und die Reviergärtner nur auf die Funktionen, die erlauben, eine manuelle Bewässerung zu starten.
Steuerung ersetzt keine Pflanzenkenntnisse
Wikipedia sagt: „Smart Home dient als Oberbegriff für technische Verfahren und Systeme in Wohnräumen und -häusern, in deren Mittelpunkt eine Erhöhung von Wohn- und Lebensqualität, Sicherheit und effizienter Energienutzung auf Basis vernetzter und fernsteuerbarer Geräte und Installationen sowie automatisierbarer Abläufe steht." Dies gilt analog für Smart-Garden-Anwendungen und eben auch für die Steuerung von Bewässerungsanlagen. Wie bei allen „smarten" Anwendungen der KI (Künstlichen Intelligenz) oder der IoT (Intelligence of Things) ist aber immer noch der Mensch die denkende Instanz. Die KI kann im Zusammenhang mit einer Bewässerungssteuerung nur die Befehle umsetzen, die ein Mensch mit Kenntnis der Ansprüche der Pflanzen angibt, und in Verbindung mit den Funktionen ausführen, die die Programmierer implantiert haben. Mangelnde Pflanzenkenntnis kann auch nicht durch eine cloudbasierte „intelligente" Bewässerungssteuerung ersetzt werden.
Sicherheit geht vor
Vor allem in Hinblick auf die Datensicherheit gibt es beim Verbindungsaufbau große Unterschiede. Immer wieder wird von kritischen Sicherheitslücken in Smart Devices berichtet. Auch wenn die Anwendungen vorrangig zu Hause und in kleinen Gewerbebetrieben Verwendung finden, stellen sie auch für Unternehmen einen potenziellen Angriffsvektor dar. Dies ist umso beunruhigender, da in Zeiten der Corona-Pandemie immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten und über private WLAN-Router an die Unternehmen angebunden sind.
In vielen Unternehmen und Kommunen sehen die Abteilungen, die für die IT-Sicherheit zuständig sind, KI-Anwendungen aus dem Consumerbereich sehr kritisch und werden den Zugang eventuell nicht erlauben. Für diesen Fall, oder um ganz sicher zu gehen, sollte man auf Geräte mit GPRS-Schnittstelle zurückgreifen, oder für die Bewässerungsanlage einen GPRS-WLAN-Router mit fester IP verwenden, um die Smart-Devices an das Internet anzubinden.
Erfahrungen eines Spezialisten
Sven Otto, Eigentümer der Firma Aqua-in-Motion (Bewässerungstechnik, Wasserspiele, www.aqua-in-motion.de) gehört zu den Pionieren der Fernüberwachung im Bereich Bewässerung im Hausgarten und hatte einige Anlagen mit der GPRS-Steuerung „Futura" der Firma Claber ausgerüstet. Nachdem Claber die Sparte Claber-Meteo geschlossen hat, die Geräte nicht mehr herstellt und keinen Support mehr anbietet, hat sich Otto für die Steuergeräte der Firma Hunter entschieden, die über die cloudbasierte Software „Hydrawise" gesteuert werden. DEGA hat ihn gefragt, welche positiven und welche negativen Aspekte ihm in Bezug auf die Hunter-Hydrawise-Software besonders wichtig sind:Der große Vorteil der Fernüberwachung der Bewässerungsanlagen liegt darin, dass wir als Spezialisten mit gärtnerischem Wissen für unsere Kunden vom Büro aus die Einrichtung und Programmierung der Anlage abnehmen und jederzeit die Einstellungen verändern können.Bei klassischen Steuergeräten mussten meine Monteure oder ich zum Teil weite Strecken zurücklegen, um vor Ort die Änderungen an den Einstellungen vorzunehmen. Aufgrund der Trinkwasserverordnung rüsten wir auch Trinkwassergespeiste Anlagen mit einer Trennstation aus. Das bedeutet, dass im Prinzip alle unsere Anlagen von einer Pumpe gespeist werden. Aus diesem Grund sind die meisten unserer Anlagen mit einem Durchflusssensor ausgerüstet, mit dessen Hilfe wir überwachen können, ob die Pumpen Wasser fördern. Der Durchflusssensor erkennt auch Leckagen. Die Software lernt selbstständig den Sollwert und sendet eine Fehlermeldung bei zu geringem oder zu hohem Durchfluss. Erst dann müssen wir vor Ort, um den Schaden zu beheben.Nachteilig ist, dass von den in der Regel 13 Kanälen des Routers nur die Kanäle 1 bis 11 genutzt werden können. Bei automatischer Zuweisung kann dies zu Problemen führen, weshalb ein Kanal zwischen 1 und 11 fest dem Hydrawise Steuergerät zugewiesen werden muss, wofür gegebenenfalls ein IT-Spezialist notwendig ist. Nachteilig ist auch, dass es keine deutschsprachige Hotline von Hunter gibt. Aufgrund der fehlenden Möglichkeit, verschiedene Hierarchiestufen mit definierten Benutzerrechten einzurichten, verwenden wir die Hydrawise-Steuerung nur für Hausgärten und kleinere Gewerbeeinheiten mit nur wenigen Nutzern. Umständlich ist auch, ein bereits einem Nutzerkonto zugeordnetes Gerät einem neuen Nutzer zuzuweisen."

Produkte von Hunter, Claber, Netafim, Toro, Rainbird, Samcla, Perrot und weiterer Anbieter von Profi-Bewässerungstechnik, Teich- und Springbrunnentechnik sowie Gartenbeleuchtung bieten
Kresko GmbH www.kresko.de
Tegtmeier-Gartentechnik www.tegtmeier-info.de

Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen


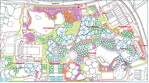




Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.